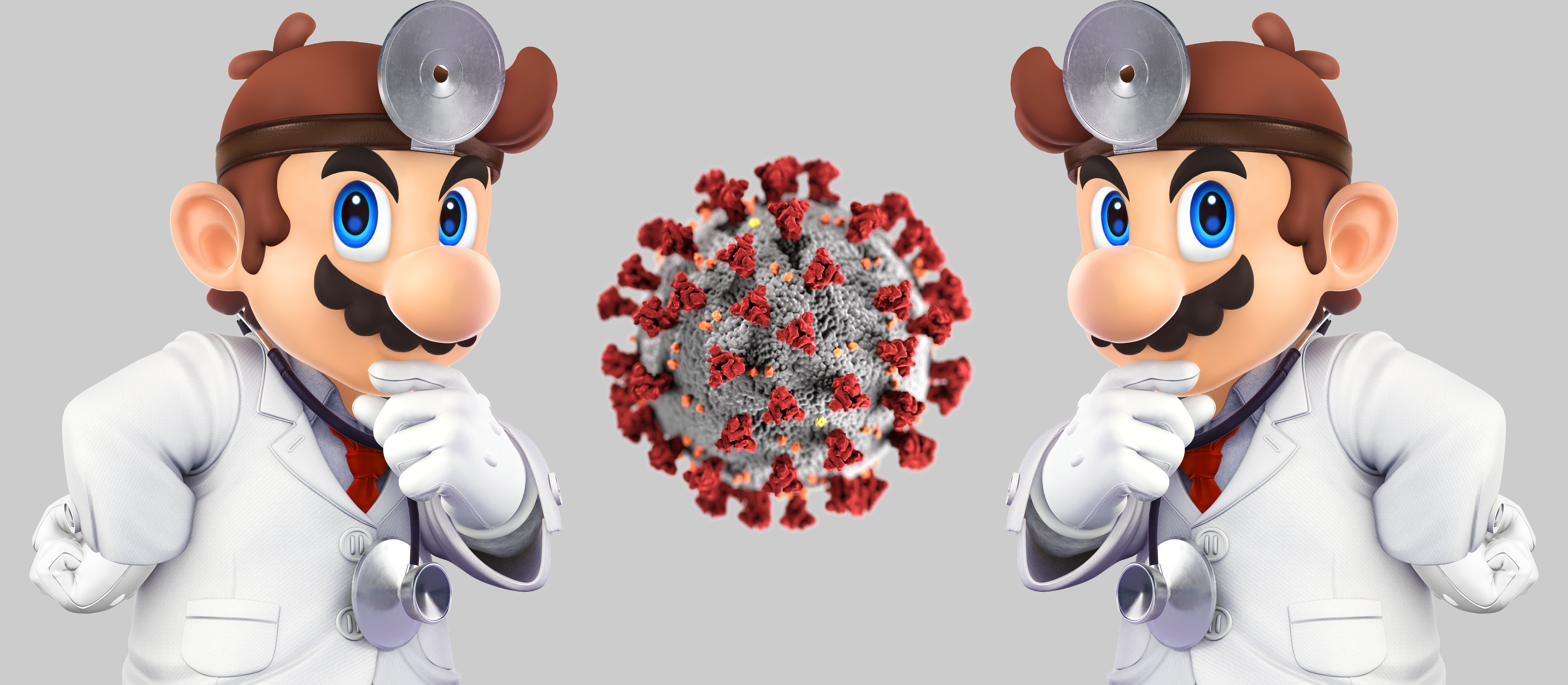In dieser Kolumne wird unser Redakteur Tyll Leyh erwachsen. Das ist zumindest der Plan. Er probiert Hobbys, scheitert und liefert dabei Einblicke in sein Seelenleben. Diese Woche ist auch unser Kolumnist verunsichert und sucht Trost in der Mittelmäßigkeit der öffentlich-rechtlichen TV-Landschaft. Er schaut Tatort.
Vor zwei Wochen war ich mir noch sicher, dass dieser Fixstern der Sonntagabendunterhaltung, den so viele Menschen aus purer Gewohnheit schauen, einer Besprechung bedarf. Inzwischen frage ich mich, ist das überhaupt noch relevant? Sollte ich nicht darüber schreiben, wie ich hyperventilierend vor den Nachrichten sitze?
Dann bin ich allerdings zu der Überzeugung gekommen, dass der Tatort eigentlich alles besitzt, was wir in dieser Krise, diesen unsicheren Zeiten, gebrauchen können: Stabilität, Verlässlichkeit und ein Gefühl für Langeweile. Denn wer 90 Minuten deutschsprachige Polizeiarbeit aushält, hält auch Wochen oder Monate der Quarantäne aus. Der Tatort ist immer noch hochaktuell in seiner Funktion, möglichst seicht abzulenken und bereitet uns seit 1100 Folgen auf genau diesen aktuellen Ernstfall vor.
Und da das letzte Schmuckstück deutscher Fernsehkunst im ORF wegen einer Spezialausgabe Wien Heute gar nicht zu sehen war, lohnt es sich gleich doppelt, davon zu erzählen, dass Berlin mehr zu bieten hat als Gentrifizierung, Spätis und Clan-Kriminalität. Nämlich privilegierte Jurastudenten und deren finsteren Versuch, das perfekte Verbrechen zu begehen.
„Ein paar Schüsse werden dir gut tun.“
Als Vorbereitung und gegen die Langeweile sei auch empfohlen, sich mal die fiktiven Biografien der Tatortermittler*innen auf ARD.de durchzulesen. Da erfährt man dann zum Beispiel, dass die Berliner Ermittlerin ihre „Sehnsucht nach maximaler Intensität“ im Berliner Nachtleben heraustanzt (alles klar), oder ihr Kollege, der Hauptkomissar Robert Karow „über hohe Abstraktionsfähigkeit und ein brilliant logisches, beängstigend schnelles Denkvermögen“ verfügt und seine Biografie scheinbar selber schreiben durfte.
Ansonsten spielt das sonst gerne einmal ausgebreitete Privatleben der Ermittler*innen in dieser Episode keine Rolle, wohl zu wichtig und komplex der Fall.
Vorweg: Ich weiß jetzt, dass sich Fernsehteams schnöselige Jurastudenten und deren Geheimbünde genauso vorstellen wie wir anderen auch. Mit wunderschönen Namen (Theodor Alexander Freiherr zu Quembach), absurd komischen Einweihungsriten mit Masken und Kutten, sowie strengen Vätern, die mal wieder enttäuscht von ihren Söhnen sind. Wer da drinsteckt, der muss eigentlich zwangsläufig einen Mord begehen. Das passiert dann natürlich auch, mitten auf dem Berliner Gendarmenmarkt wird eine Studentin um zwölf Uhr mittags mit Kopfschuss getötet. Als Schussposition kommt nur ein Übungsraum der Berlin School of Law in Frage. Dann treten die Studenten auf, sind aalglatt und werfen mit lateinischen Wörtern und Sätzen wie „die Sache hat einen Haken, der Club ist man-only“ um sich. Man leidet förmlich mit, wenn dann zufälligerweise auch noch die Bockbüchsflinte verschwunden ist.
Soviel zur Ausgangssituation. Schnell stellt sich heraus, dass das neueste Mitglied einen Vortrag über das perfekte Verbrechen halten musste. Zufall? Natürlich nicht und so arbeitet sich auch der Tatort mal an diesem alten Sujet ab, das es von Hitchcock über zahlreiche amerikanische Adaptionen endlich auch mal wieder ins deutsche TV geschafft hat:
Einen Mord zu begehen, ohne dafür mit Konsequenzen rechnen zu müssen.
Da es soweit natürlich nicht kommen darf, wird so richtig losermittelt, Indizien werden gesammelt, Befragungen geführt und sich langsam an die unvermeidliche Lösung herangetastet. Denn darum geht es im Tatort wirklich: Zu zeigen, dass auch noch in jedem Kaff, in jeder schlecht herbeigeschriebenen Subkultur, in wirklich jedem Milieu ein Mord passiert. Zum Glück aber niemand unbestraft damit davon kommt.
Es gibt nämlich die genialen Komissar*innen, kühle Köpfe, die klüger sind als die Täter und zeigen, dass jede Rundfunkanstalt das Recht hat, hölzerne Dialoge zu schreiben und einen Mord aufzuklären.
Also liege ich da auf der Couch und bin nicht wirklich überrascht davon, dass der Täter die Ermittler mal wieder an der Nase herumführen will, was natürlich nicht gelingt. Ein bis zwei falsche Fährten später folgt dann das etwas konfuse Finale in sehr interessantem Setting. Worüber ich natürlich weiter nichts erzähle, da viele die Folge sicher nachholen wollen. Es sei nur soviel verraten: Da dem Tatort grundlegende Veränderungen eher fremd sind, geht auch hier niemand ungestraft nach Hause. Ich zappe danach mit einem müden „Naja“ zurück auf die Nachrichten und bin erstaunt darüber, dass auch hier immer noch alles den selben geregelten, ungeregelten Bahnen nachgeht.
„Sie etwa nicht? Armut ist eine Geisteshaltung.“
Der Tatort führt uns in die fiktive Welt des Verbrechens und befriedigt dabei unsere tägliche Sehnsucht nach Kriminalfällen, nach dem bisschen Mord und Totschlag am Abend, aber ganz gelassen und harmlos. Es geht gar nicht so sehr um den Fall selbst, als darum, dass er auch abgeschlossen wird, gelöst. Keine Fragen mehr offen bleiben. Diese befriedigende Eigenart macht wahrscheinlich den Erfolg aus. Der Tatort ist kein Arthousekrimi, kein anstrengendes Whodunit, kein Blockbuster, sondern dasselbe in 1001-facher Variation aus allen Ecken des deutschen Sprachraumes:
Gelebte Vorhersehbarkeit
Ich weiß, dass auch nächste Woche das Böse bekommt, was es verdient und ich dabei vielleicht einschlafen werde. Das ist doch immerhin etwas. Eben genau die Verlässlichkeit, die dem aktuellen Tagesgeschehen oder dem Ausbleiben desgleichen entgegensteht. Und jeder weiß, er hat ein absehbares Ende.
Da meine Möglichkeiten in nächster Zeit hingegen nicht absehbar sind, eher etwas eingeschränkt, folgt als nächstes mein ganz persönliches Zwischenfazit und Tyll tut #11 – Nichts.
Erfolgserlebnisse: 1,5 h nicht die Hände gewaschen 9/10
Macht fit und belastbar: 1,5 h fast nicht eingeschlafen 7/10
Fühlt sich nach Arbeit an: Nö 1/10
Preislich skalierbar: Kostet fast nichts, außer Zeit 2/10
Spaß: Netflix ist es nicht 6/10
Gesamt: 25/50
Ich weiß auch nicht, wie man das schreibt.